Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung.
Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an
nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen,
Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen
auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.
LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung
durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!
Möchten Sie mehr zu den Hintergründen unserer Metainformationen erfahren? Dann besuchen Sie doch unsere FAQ-Seite.
- 1.
- Zu Versuchszwecken und für einen begrenzten Zeitraum kann die zuständige Behörde aufgrund einer Empfehlung der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt für ein Fahrzeug, bei dem Aufgaben der Besatzung automatisiert wahrgenommen werden, oder für ein ferngesteuertes Fahrzeug Abweichungen von dieser Verordnung erlauben.
- 2.
- Die Empfehlung legt Mindestanforderungen fest, die gewährleisten, dass das Fahrzeug
- a)
- die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt und
- b)
- über ein den anderen auf dem Rhein verkehrenden Fahrzeugen gleichwertiges Sicherheitsniveau verfügt.
- 3.
- Die zuständige Behörde trägt die Abweichungen nach Nummer 1 und die Anforderungen nach Nummer 2 in das Schiffsattest des betroffenen Fahrzeugs oder das nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung als gleichwertig anerkannte Zeugnis ein.
| 1. | Zwischen der Mittleren Rheinbrücke in Basel (km 166,53) und den Schleusen Kembs (km 179,10) sowie zwischen den Schleusen Iffezheim (km 334,00) und der Spyck’schen Fähre (km 857,40) ist die Schifffahrt bei Hochwasserständen zwischen den Marken I und II nachstehenden Beschränkungen unterworfen: | ||
| a) | alle Fahrzeuge - mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb - müssen sich in der Talfahrt möglichst in der Mitte, in der Bergfahrt im mittleren Drittel des Stromes halten; als Breite des Stromes gilt der Abstand zwischen den Uferlinien; beim Fahren einschließlich des Überholens sind höchstens bis zu zwei Schiffs- oder Verbandsbreiten zulässig; | ||
| b) | erfordern es die örtlichen Verhältnisse, abweichend von Buchstabe a näher an ein Ufer heranzufahren, müssen alle dort genannten Fahrzeuge dennoch möglichst weit vom Ufer entfernt bleiben und ihre Geschwindigkeit entsprechend vermindern; | ||
| c) | § 9.04 bleibt unberührt. Zwischen Lorch (km 540,20) und St. Goar (km 556,00) hat die Bergfahrt das mittlere Drittel des Stromes aber so weit zum linken Ufer einzuhalten, daß die Begegnung mit der Talfahrt ohne Gefahr Backbord an Backbord stattfinden kann; | ||
| d) | unbeschadet des § 6.20 darf die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge gegenüber dem Ufer 20 km in der Stunde nicht überschreiten, ausgenommen die Talfahrt in der Gebirgsstrecke zwischen Bingen (km 528,50) und St. Goar (km 556,00), in der die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge gegenüber dem Ufer 24 km in der Stunde nicht überschreiten; überschreiten darf; | ||
| e) | nach Überschreiten der Hochwassermarke I dürfen innerhalb des entsprechenden Streckenabschnitts nur solche Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen, die mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet sind. Sie müssen den Verkehrskreis Nautische Information auf Empfang geschaltet haben. Dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge, die mit Muskelkraft fortbewegt werden; | ||
| f) | nach Überschreiten der Hochwassermarke I ist schnellen Schiffen die Fahrt verboten. | ||
| 2. | Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hochwassermarke II an dem Richtpegel für den unter Nummer 3 aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schiffahrt mit Ausnahme des Übersetzverkehrs innerhalb des Streckenabschnitts verboten. | ||
| 3. | Die in Nummer 1 und 2 genannten Hochwassermarken werden durch folgende Wasserstände bestimmt und die Richtpegel für die Berg- oder Talfahrt gelten für die nachstehend aufgeführten Streckenabschnitte: | ||
| 1. | Zwischen der Mittleren Rheinbrücke in Basel (km 166,53) und den Schleusen Kembs (km 179,10) sowie zwischen den Schleusen Iffezheim (km 334,00) und der Spyck’schen Fähre (km 857,40) ist die Schifffahrt bei Hochwasserständen zwischen den Marken I und II nachstehenden Beschränkungen unterworfen: | ||
| a) | alle Fahrzeuge - mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb - müssen sich in der Talfahrt möglichst in der Mitte, in der Bergfahrt im mittleren Drittel des Stromes halten; als Breite des Stromes gilt der Abstand zwischen den Uferlinien; beim Fahren einschließlich des Überholens sind höchstens bis zu zwei Schiffs- oder Verbandsbreiten zulässig; | ||
| b) | erfordern es die örtlichen Verhältnisse, abweichend von Buchstabe a näher an ein Ufer heranzufahren, müssen alle dort genannten Fahrzeuge dennoch möglichst weit vom Ufer entfernt bleiben und ihre Geschwindigkeit entsprechend vermindern; | ||
| c) | § 9.04 bleibt unberührt. Zwischen Lorch (km 540,20) und St. Goar (km 556,00) hat die Bergfahrt das mittlere Drittel des Stromes aber so weit zum linken Ufer einzuhalten, daß die Begegnung mit der Talfahrt ohne Gefahr Backbord an Backbord stattfinden kann; | ||
| d) | unbeschadet des § 6.20 darf die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge gegenüber dem Ufer 20 km in der Stunde nicht überschreiten, ausgenommen die Talfahrt in der Gebirgsstrecke zwischen Bingen (km 528,50) und St. Goar (km 556,00), in der die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge gegenüber dem Ufer 24 km in der Stunde nicht überschreiten; überschreiten darf; | ||
| e) | nach Überschreiten der Hochwassermarke I dürfen innerhalb des entsprechenden Streckenabschnitts nur solche Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen, die mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet sind. Sie müssen den Verkehrskreis Nautische Information auf Empfang geschaltet haben. Dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge, die mit Muskelkraft fortbewegt werden; | ||
| f) | nach Überschreiten der Hochwassermarke I ist schnellen Schiffen die Fahrt verboten. | ||
| 2. | Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hochwassermarke II an dem Richtpegel für den unter Nummer 3 aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schiffahrt mit Ausnahme des Übersetzverkehrs innerhalb des Streckenabschnitts verboten. | ||
| 3. | Die in Nummer 1 und 2 genannten Hochwassermarken werden durch folgende Wasserstände bestimmt und die Richtpegel für die Berg- oder Talfahrt gelten für die nachstehend aufgeführten Streckenabschnitte: | ||
Strecke | Richtpegel für Berg- und Talfahrt Wasserstand | |
| Marke I | Marke II | |
| Basel (km 166,53) | ||
| Basel-Schleusen Kembs Kembs (km 179,10) | Basel-Rheinhalle 7,00 8,20 | |
| Schleusen Iffezheim (km 334,00) | ||
| Schleusen Iffezheim-Germersheim Germersheim (km 384,00) | Maxau 6,20 7,50 | |
| Germersheim-Mannheim-Rheinau Mannheim-Rheinau (km 410,50) | Speyer 6,20 7,30 | |
| Mannheim-Rheinau-Mannheim-Sandhofen Mannheim-Sandhofen (km 431,50) | Mannheim 6,50 7,60 | |
| Mannheim-Sandhofen-Gernsheim Gernsheim (km 462,00) | Worms 4,40 6,50 | |
| Gernsheim-Eltville Eltville (km 511,00) | Mainz 4,75 6,30 | |
| Eltville-Lorch Lorch (km 540,00) | Bingen 3,50 4,90 | |
| Lorch-Bad Salzig Bad Salzig (km 566,00) | Kaub 4,60 6,40 | |
| Bad Salzig-Engers Engers (km 601,00) | Koblenz 4,70 6,50 | |
| Engers-Bad Breisig Bad Breisig (km 624,00) | Andernach 5,50 7,60 | |
| Bad Breisig-Mondorf Mondorf (km 660,00) | Oberwinter 4,90 6,80 | |
| Mondorf-Dormagen Dormagen (km 710,00) | Köln 6,20 8,30 | |
| Dormagen-Krefeld Krefeld (km 763,00) | Düsseldorf 7,10 8,80 | |
| Krefeld-Orsoy Orsoy (km 794,00) | Duisburg-Ruhrort 9,30 11,30 | |
| Orsoy-Rees Rees (km 837,00) | Wesel 8,70 10,60 | |
| Rees-Spyck'sche Fähre Spyck'sche Fähre (km 857,40) | Emmerich 7,00 8,70 | |
| 4. | Zwischen Basel und den Schleusen Kembs können die zuständigen Behörden einzelnen Fahrzeugen und Verbänden für diesen Streckenabschnitt bis zu einem Wasserstand von 8,50 m am Pegel Basel-Rheinhalle die Fahrt freigeben, wenn der Wasserstand bereits seit mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen überwiegend über der Marke von 8,20 m lag und die Vorhersagen dahin gehen, dass der Wasserstand auch an den folgenden zwei Tagen noch über dieser Marke liegen wird. | |||
| 5. | Zwischen den Schleusen Kembs und den Schleusen Iffezheim (km 334,00) wird die Schiffahrt bei Hochwasser wie folgt geregelt: | |||
| a) | zwischen dem oberen Vorhafen der Schleusen Kembs und dem oberen Vorhafen der Schleusen Vogelgrün ist die Schiffahrt keinen Beschränkungen wegen Hochwassers unterworfen. Die zuständige Behörde kann jedoch, um Ansammlungen von Fahrzeugen in den Vorhäfen der Schleusen Kembs und Vogelgrün zu vermeiden, die Fahrzeuge auf die Vorhäfen der verschiedenen Schleusen verteilen; | |||
| b) | zwischen den Schleusen Vogelgrün und den Schleusen Iffezheim | |||
| - | wird der Betrieb der Schleusen einer gegebenen Haltung eingestellt, wenn die auf einer Mauer bei dem Unterhaupt dieser Schleusen sichtbar angebrachte Hochwassermarke II erreicht oder überschritten ist; | |||
| - | ist Kleinfahrzeugen die Fahrt in einer Haltung verboten, wenn die an dem Unterhaupt der jeweils oberhalb liegenden Schleuse sichtbar angebrachte Hochwassermarke II erreicht oder überschritten ist. | |||
| Jedoch kann die zuständige Behörde einzelnen Fahrzeugen und Verbänden für den Streckenabschnitt von unterhalb der Schleuse Vogelgrün bis unterhalb der Schleuse Straßburg bis zu einem Wasserstand von 0,40 m über der angebrachten Hochwassermarke II die Fahrt und die Schleusungen freigeben, wenn der Wasserstand bereits seit mehr als drei aufeinander folgenden Tagen überwiegend über der Hochwassermarke II lag und die Vorhersagen dahin gehen, dass der Wasserstand auch an den folgenden zwei Tagen noch über dieser Hochwassermarke liegen wird; | ||||
| c) | auf der Stromstrecke zwischen dem südlichen Vorhafen (km 291,30) und dem nördlichen Vorhafen (km 295,50) des Straßburger Hafens wird die Schiffahrt bei Erreichen des höchsten Schiffahrtswasserstandes (HSW) wie folgt gesperrt: | |||
| - | in der Talfahrt durch ein bei km 291,30 | 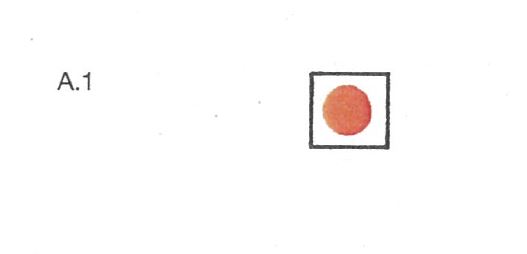 | ||
| aufgestelltes rotes Licht (Zeichen A.1, Anlage 7); | ||||
| - | in der Bergfahrt durch ein bei km 294,50 | |||
| aufgestelltes rotes Licht (Zeichen A.1, Anlage 7). | ||||
- 1.
- Ein Fahrzeug darf die Höchstlänge von 135 m und die Breite von 22,80 m nicht überschreiten.
Die Breite darf- a)
- für den Stromabschnitt zwischen Bingen (km 528,50) und St. Goar (km 556,00) 17,70 m und
- b)
- für den Stromabschnitt zwischen Pannerden (km 867,46) und Lekkanal (km 949,40) 15 m
- 2.
- Die für den jeweiligen Stromabschnitt zuständigen Behörden dürfen hinsichtlich der Breite eine Sondererlaubnis für die Fahrt erteilen.
- 3.
- Ein Fahrzeug mit einer Länge über 110 m darf nur fahren, wenn sich an Bord eine Person befindet, die die nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige besondere Berechtigung für Radarfahrten besitzt.
- 4.
- Ein Fahrzeug, ausgenommen ein Fahrgastschiff, mit einer Länge über 110 m darf oberhalb von Mannheim nur fahren, wenn es die Anforderungen des Artikels 28.04 Nummer 2 ES-TRIN erfüllt. Ein Fahrgastschiff mit einer Länge über 110 m darf oberhalb von Mannheim nur fahren, wenn es die Anforderungen des Artikels 28.04 Nummer 3 ES-TRIN erfüllt. Die von den für den jeweiligen Stromabschnitt zwischen Basel und Mannheim zuständigen Behörden erteilten und am 30. September 2001 gültigen Sondererlaubnisse für Fahrzeuge über 110 m bis 135 m Länge bleiben mit den aus Sicherheitsgründen erteilten notwendigen Auflagen auf dem jeweiligen Stromabschnitt weiterhin gültig.
- 5.
- Ein Fahrgastschiff darf unterhalb von Emmerich (km 885) 855) nur fahren, wenn es die Anforderungen des Artikels 13.01 Nummer 2 Buchstabe b ES-TRIN erfüllt.
- 1.
- Ein Fahrzeug darf die Höchstlänge von 135 m und die Breite von 22,80 m nicht überschreiten.
Die Breite darf- a)
- für den Stromabschnitt zwischen Bingen (km 528,50) und St. Goar (km 556,00) 17,70 m und
- b)
- für den Stromabschnitt zwischen Pannerden (km 867,46) und Lekkanal (km 949,40) 15 m
- 2.
- Die für den jeweiligen Stromabschnitt zuständigen Behörden dürfen hinsichtlich der Breite eine Sondererlaubnis für die Fahrt erteilen.
- 3.
- Ein Fahrzeug mit einer Länge über 110 m darf nur fahren, wenn sich an Bord eine Person befindet, die die nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige besondere Berechtigung für Radarfahrten besitzt.
- 4.
- Ein Fahrzeug, ausgenommen ein Fahrgastschiff, mit einer Länge über 110 m darf oberhalb von Mannheim nur fahren, wenn es die Anforderungen des Artikels 28.04 Nummer 2 ES-TRIN erfüllt. Ein Fahrgastschiff mit einer Länge über 110 m darf oberhalb von Mannheim nur fahren, wenn es die Anforderungen des Artikels 28.04 Nummer 3 ES-TRIN erfüllt. Die von den für den jeweiligen Stromabschnitt zwischen Basel und Mannheim zuständigen Behörden erteilten und am 30. September 2001 gültigen Sondererlaubnisse für Fahrzeuge über 110 m bis 135 m Länge bleiben mit den aus Sicherheitsgründen erteilten notwendigen Auflagen auf dem jeweiligen Stromabschnitt weiterhin gültig.
- 5.
- Ein Fahrgastschiff darf unterhalb von Emmerich (km 885) 855) nur fahren, wenn es die Anforderungen des Artikels 13.01 Nummer 2 Buchstabe b ES-TRIN erfüllt.
- 1.
- Die Schiffsführer folgender Fahrzeuge und der Verbände müssen sich vor der Einfahrt in die unter Nummer 3 genannten Strecken elektronisch gemäß den Bestimmungen von Teil IV „Standard für elektronisches Melden in der Binnenschifffahrt“ des ES-RIS melden:
- a)
- Fahrzeuge, die Güter an Bord haben, deren Beförderung dem ADN unterliegt;
- b)
- Tankschiffe, ausgenommen Bunkerboote und Bilgenentölungsboote im Sinne des Abschnitts 1.2.1 der dem ADN beigefügten Verordnung;
- c)
- Fahrzeuge, die Container befördern;
- d)
- Fahrzeuge mit einer Länge über 110 m;
- e)
- Kabinenschiffe;
- f)
- Seeschiffe;
- g)
- Fahrzeuge, die ein LNG-System an Bord haben;
- h)
- Sondertransporte nach § 1.21.
- 2.
- Im Rahmen der Meldung nach Nummer 1 sind anzugeben:
- a)
- Schiffsname des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband;
- b)
- einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI), bei Seeschiffen IMO-Nummer des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband;
- c)
- Art des Fahrzeugs oder Verbands und bei Verbänden Art aller Fahrzeuge gemäß der Nachricht nach Nummer 1;
- d)
- Tragfähigkeit des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband;
- e)
- Länge und Breite des Fahrzeugs und bei Verbänden Länge und Breite des Verbands und aller Fahrzeuge im Verband;
- f)
- Vorhandensein eines LNG-Systems an Bord;
- g)
- bei Fahrzeugen, die Güter an Bord haben, deren Beförderung dem ADN unterliegt:
- aa)
- die UN-Nummer oder Nummer des Gefahrguts;
- bb)
- die offizielle Benennung für die Beförderung des Gefahrguts;
- cc)
- die Klasse, den Klassifizierungscode und gegebenenfalls die Verpackungsgruppe des Gefahrguts;
- dd)
- die Gesamtmenge der gefährlichen Güter, für die diese Angaben gelten;
- ee)
- die Anzahl blauer Lichter/blauer Kegel;
- h)
- bei Fahrzeugen, die Güter an Bord haben, deren Beförderung nicht dem ADN unterliegt und die nicht in einem Container befördert werden: Art und Menge der Ladung;
- i)
- Anzahl der an Bord befindlichen Container entsprechend ihrer Größe und ihres Beladungszustandes (beladen oder unbeladen) sowie jeweilige Stauplanposition und Typ der Container;
- j)
- Containernummer der Gefahrgutcontainer;
- k)
- Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen und sofern zutreffend Anzahl der Fahrgäste;
- l)
- Standort, Fahrtrichtung;
- m)
- Tiefgang (nur auf besondere Aufforderung);
- n)
- Fahrtroute mit Angabe von Start- und Zielhafen;
- o)
- Beladehafen;
- p)
- Entladehafen.
- 3.
- Die Meldepflicht nach Nummer 1 besteht auf folgenden Strecken, die mit dem Tafelzeichen B.11 und einer Zusatztafel „Meldepflicht“ gekennzeichnet sind:
- a)
- von Basel (Mittlere Rheinbrücke km 166,53) bis Gorinchem (km 952,50) und
- b)
- von Pannerden (km 876,50) 867,50) bis Krimpen am Lek (km 989,20).
- 4.
- Unterbricht ein Fahrzeug in einer der unter Nummer 3 genannten Strecken die Fahrt für mehr als zwei Stunden, muss der Schiffsführer Beginn und Ende der Unterbrechung auf elektronischem Wege melden.
- 5.
- Beim Durchfahren von Schleusen und beim Vorbeifahren an den mit dem Tafelzeichen B.11 gekennzeichneten Meldepunkten muss der Schiffsführer die Angaben nach Nummer 2 Buchstabe a und c über Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal melden. Abweichend von Nummer 2 Buchstabe c muss der Schiffsführer die Art des Fahrzeugs oder Verbands gemäß Anlage 12 angeben.
- 6.
- Die unter Nummer 2 genannten Angaben mit Ausnahme von Buchstabe l und m können auch von anderen Stellen oder Personen auf elektronischem Wege der zuständigen Behörde mitgeteilt werden. In jedem Fall muss der Schiffsführer über Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal melden, wenn er mit seinem Fahrzeug oder Verband in die Strecke, auf der die Meldepflicht gilt, einfährt und diese wieder verlässt.
- 7.
- Ändern sich die Angaben nach Nummer 2 während der Fahrt in der Strecke, auf der die Meldepflicht gilt, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich auf elektronischem Wege mitzuteilen.
- 8.
- Wenn die Fahrt beendet ist, muss der Schiffsführer dies unverzüglich elektronisch melden.
- 9.
- Die zuständige Behörde
- -
- kann für Bunkerboote und Bilgenentölungsboote im Sinne des Abschnitts 1.2.1 der dem ADN beigefügten Verordnung sowie Tagesausflugsschiffe eine Meldepflicht und deren Umfang festlegen,
- -
- kann bei der Erteilung einer besonderen Erlaubnis für Sondertransporte nach § 1.21 eine Ausnahme von der Meldepflicht nach Nummer 1 gewähren.
- 1.
- Die Schiffsführer folgender Fahrzeuge und der Verbände müssen sich vor der Einfahrt in die unter Nummer 3 genannten Strecken elektronisch gemäß den Bestimmungen von Teil IV „Standard für elektronisches Melden in der Binnenschifffahrt“ des ES-RIS melden:
- a)
- Fahrzeuge, die Güter an Bord haben, deren Beförderung dem ADN unterliegt;
- b)
- Tankschiffe, ausgenommen Bunkerboote und Bilgenentölungsboote im Sinne des Abschnitts 1.2.1 der dem ADN beigefügten Verordnung;
- c)
- Fahrzeuge, die Container befördern;
- d)
- Fahrzeuge mit einer Länge über 110 m;
- e)
- Kabinenschiffe;
- f)
- Seeschiffe;
- g)
- Fahrzeuge, die ein LNG-System an Bord haben;
- h)
- Sondertransporte nach § 1.21.
- 2.
- Im Rahmen der Meldung nach Nummer 1 sind anzugeben:
- a)
- Schiffsname des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband;
- b)
- einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI), bei Seeschiffen IMO-Nummer des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband;
- c)
- Art des Fahrzeugs oder Verbands und bei Verbänden Art aller Fahrzeuge gemäß der Nachricht nach Nummer 1;
- d)
- Tragfähigkeit des Fahrzeugs und bei Verbänden aller Fahrzeuge im Verband;
- e)
- Länge und Breite des Fahrzeugs und bei Verbänden Länge und Breite des Verbands und aller Fahrzeuge im Verband;
- f)
- Vorhandensein eines LNG-Systems an Bord;
- g)
- bei Fahrzeugen, die Güter an Bord haben, deren Beförderung dem ADN unterliegt:
- aa)
- die UN-Nummer oder Nummer des Gefahrguts;
- bb)
- die offizielle Benennung für die Beförderung des Gefahrguts;
- cc)
- die Klasse, den Klassifizierungscode und gegebenenfalls die Verpackungsgruppe des Gefahrguts;
- dd)
- die Gesamtmenge der gefährlichen Güter, für die diese Angaben gelten;
- ee)
- die Anzahl blauer Lichter/blauer Kegel;
- h)
- bei Fahrzeugen, die Güter an Bord haben, deren Beförderung nicht dem ADN unterliegt und die nicht in einem Container befördert werden: Art und Menge der Ladung;
- i)
- Anzahl der an Bord befindlichen Container entsprechend ihrer Größe und ihres Beladungszustandes (beladen oder unbeladen) sowie jeweilige Stauplanposition und Typ der Container;
- j)
- Containernummer der Gefahrgutcontainer;
- k)
- Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen und sofern zutreffend Anzahl der Fahrgäste;
- l)
- Standort, Fahrtrichtung;
- m)
- Tiefgang (nur auf besondere Aufforderung);
- n)
- Fahrtroute mit Angabe von Start- und Zielhafen;
- o)
- Beladehafen;
- p)
- Entladehafen.
- 3.
- Die Meldepflicht nach Nummer 1 besteht auf folgenden Strecken, die mit dem Tafelzeichen B.11 und einer Zusatztafel „Meldepflicht“ gekennzeichnet sind:
- a)
- von Basel (Mittlere Rheinbrücke km 166,53) bis Gorinchem (km 952,50) und
- b)
- von Pannerden (km 876,50) 867,50) bis Krimpen am Lek (km 989,20).
- 4.
- Unterbricht ein Fahrzeug in einer der unter Nummer 3 genannten Strecken die Fahrt für mehr als zwei Stunden, muss der Schiffsführer Beginn und Ende der Unterbrechung auf elektronischem Wege melden.
- 5.
- Beim Durchfahren von Schleusen und beim Vorbeifahren an den mit dem Tafelzeichen B.11 gekennzeichneten Meldepunkten muss der Schiffsführer die Angaben nach Nummer 2 Buchstabe a und c über Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal melden. Abweichend von Nummer 2 Buchstabe c muss der Schiffsführer die Art des Fahrzeugs oder Verbands gemäß Anlage 12 angeben.
- 6.
- Die unter Nummer 2 genannten Angaben mit Ausnahme von Buchstabe l und m können auch von anderen Stellen oder Personen auf elektronischem Wege der zuständigen Behörde mitgeteilt werden. In jedem Fall muss der Schiffsführer über Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal melden, wenn er mit seinem Fahrzeug oder Verband in die Strecke, auf der die Meldepflicht gilt, einfährt und diese wieder verlässt.
- 7.
- Ändern sich die Angaben nach Nummer 2 während der Fahrt in der Strecke, auf der die Meldepflicht gilt, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich auf elektronischem Wege mitzuteilen.
- 8.
- Wenn die Fahrt beendet ist, muss der Schiffsführer dies unverzüglich elektronisch melden.
- 9.
- Die zuständige Behörde
- -
- kann für Bunkerboote und Bilgenentölungsboote im Sinne des Abschnitts 1.2.1 der dem ADN beigefügten Verordnung sowie Tagesausflugsschiffe eine Meldepflicht und deren Umfang festlegen,
- -
- kann bei der Erteilung einer besonderen Erlaubnis für Sondertransporte nach § 1.21 eine Ausnahme von der Meldepflicht nach Nummer 1 gewähren.
- 1.
- In den Übernachtungshäfen Spijk (km 859,80), Lobith (km 863,40), Ijzendoorn IJzendoorn (km 907,80) 907,80), und Haaften (km 936,00) und Bergambacht (km 976,90) ist es ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde verboten:
- a)
- Fahrzeuge zu beladen oder zu entladen; entladen und außerdem in Bergambacht zu bunkern;
- b)
- Güter oder andere Gegenstände am Ufer oder auf einer Landebrücke abzustellen;
- c)
- Tanks zu entgasen;
- d)
- Fahrgäste an Bord zu nehmen oder an Land zu setzen;
- e)
- mit Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen einzufahren;
- f)
- mit Fahrzeugen einzufahren, die eine Bezeichnung nach § 3.14 Nr. Nummer 2 oder 3 führen müssen;
- g)
- länger als drei Tage hintereinander für 3 x 24 aufeinanderfolgende Stunden an den öffentlichen Liegeplätzen stillzuliegen;
- h)
- innerhalb von zwölf Stunden, Stunden nachdem die unter g genannte Periode beendet ist, wieder nach dem Verlassen des Hafens erneut in demselben Übernachtungshafen stillzuliegen;
- i)
- mit dem Hinterschiff am Ufer anzulegen;
- j)
- mit Verbänden mit einer Länge von mehr als 135 m an den Landebrücken anzulegen. und in Bergambacht an den Anlegestellenanzulegen.
- 2.
- Der Schiffsführer muss die Wahl des Liegeplatzes in den Übernachtungshäfen sowie die Abfahrt aus diesen unverzüglich den Verkehrsposten Nijmegen (Übernachtungshafen Lobith) oder Tiel (Übernachtungshafen Ijzendoorn und Haaften) mitteilen.
- Abweichend von Nummer 1 Buchstabe f dürfen im Übernachtungshafen Spijk Schiffe einfahren, die eine Bezeichnung nach§ 3.14 Nummer 2 führen müssen.
- 3.
- Abweichend von Nummer 1 Buchstabe i darf im Übernachtungshafen Spijk an der Landebrücke 10 mit dem Hinterschiff am Ufer angelegt werden.
- 4.
- Abweichend von Nummer 1 Buchstabe j darf im Übernachtungshafen Spijk an der Landebrücke 10 mit Verbänden mit einer Länge von mehr als 135 m angelegt werden.
- 5.
- Der Schiffsführer muss die Wahl des Liegeplatzes in den Übernachtungshäfen sowie die Abfahrt aus diesen unverzüglich den Verkehrsposten Nijmegen (Übernachtungshafen (Übernachtungshäfen Spijk und Lobith) Lobith), oder Tiel (Übernachtungshafen (Übernachtungshäfen Ijzendoorn IJzendoorn und Haaften) oder Dordrecht (Übernachtungshafen Bergambacht) mitteilen.
- 6.
- Die zuständige Behörde kann Anordnungen erteilen, die diesen Paragrafen Paragraphen ergänzen oder von ihm abweichen.
- 1.
- In den Übernachtungshäfen Spijk (km 859,80), Lobith (km 863,40), Ijzendoorn IJzendoorn (km 907,80) 907,80), und Haaften (km 936,00) und Bergambacht (km 976,90) ist es ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde verboten:
- a)
- Fahrzeuge zu beladen oder zu entladen; entladen und außerdem in Bergambacht zu bunkern;
- b)
- Güter oder andere Gegenstände am Ufer oder auf einer Landebrücke abzustellen;
- c)
- Tanks zu entgasen;
- d)
- Fahrgäste an Bord zu nehmen oder an Land zu setzen;
- e)
- mit Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen einzufahren;
- f)
- mit Fahrzeugen einzufahren, die eine Bezeichnung nach § 3.14 Nr. Nummer 2 oder 3 führen müssen;
- g)
- länger als drei Tage hintereinander für 3 x 24 aufeinanderfolgende Stunden an den öffentlichen Liegeplätzen stillzuliegen;
- h)
- innerhalb von zwölf Stunden, Stunden nachdem die unter g genannte Periode beendet ist, wieder nach dem Verlassen des Hafens erneut in demselben Übernachtungshafen stillzuliegen;
- i)
- mit dem Hinterschiff am Ufer anzulegen;
- j)
- mit Verbänden mit einer Länge von mehr als 135 m an den Landebrücken anzulegen. und in Bergambacht an den Anlegestellenanzulegen.
- 2.
- Der Schiffsführer muss die Wahl des Liegeplatzes in den Übernachtungshäfen sowie die Abfahrt aus diesen unverzüglich den Verkehrsposten Nijmegen (Übernachtungshafen Lobith) oder Tiel (Übernachtungshafen Ijzendoorn und Haaften) mitteilen.
- Abweichend von Nummer 1 Buchstabe f dürfen im Übernachtungshafen Spijk Schiffe einfahren, die eine Bezeichnung nach§ 3.14 Nummer 2 führen müssen.
- 3.
- Abweichend von Nummer 1 Buchstabe i darf im Übernachtungshafen Spijk an der Landebrücke 10 mit dem Hinterschiff am Ufer angelegt werden.
- 4.
- Abweichend von Nummer 1 Buchstabe j darf im Übernachtungshafen Spijk an der Landebrücke 10 mit Verbänden mit einer Länge von mehr als 135 m angelegt werden.
- 5.
- Der Schiffsführer muss die Wahl des Liegeplatzes in den Übernachtungshäfen sowie die Abfahrt aus diesen unverzüglich den Verkehrsposten Nijmegen (Übernachtungshafen (Übernachtungshäfen Spijk und Lobith) Lobith), oder Tiel (Übernachtungshafen (Übernachtungshäfen Ijzendoorn IJzendoorn und Haaften) oder Dordrecht (Übernachtungshafen Bergambacht) mitteilen.
- 6.
- Die zuständige Behörde kann Anordnungen erteilen, die diesen Paragrafen Paragraphen ergänzen oder von ihm abweichen.
- 1.
- In dem Schutz- und Sicherheitshafen Emmerich (km 851,78) ist es ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde verboten:
- a)
- mit Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen einzufahren;
- b)
- mit Fahrzeugen einzufahren, die eine Bezeichnung nach § 3.14 Nummer 1, 2 oder 3 führen müssen;
- c)
- länger als 3 x 24 aufeinanderfolgende Stunden stillzuliegen;
- d)
- innerhalb von zwölf Stunden nach dem Verlassen des Hafens erneut in diesem stillzuliegen;
- e)
- eine Liegestelle mit einem von einem Verband getrennten Leichter zu belegen.
- 2.
- Die zuständige Behörde kann Anordnungen erteilen, die diesen Paragraphen ergänzen oder von ihm abweichen.
- 1.
- In dem Schutz- und Sicherheitshafen Emmerich (km 851,78) ist es ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde verboten:
- a)
- mit Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen einzufahren;
- b)
- mit Fahrzeugen einzufahren, die eine Bezeichnung nach § 3.14 Nummer 1, 2 oder 3 führen müssen;
- c)
- länger als 3 x 24 aufeinanderfolgende Stunden stillzuliegen;
- d)
- innerhalb von zwölf Stunden nach dem Verlassen des Hafens erneut in diesem stillzuliegen;
- e)
- eine Liegestelle mit einem von einem Verband getrennten Leichter zu belegen.
- 2.
- Die zuständige Behörde kann Anordnungen erteilen, die diesen Paragraphen ergänzen oder von ihm abweichen.
| Erster Teil | |||
| Auf der gesamten Rheinstrecke anwendbare Bestimmungen | |||
| Kapitel 1 | |||
| Allgemeine Bestimmungen | |||
| § 1.01 | Begriffsbestimmungen | ||
| § 1.02 | Schiffsführer | ||
| § 1.03 | Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord | ||
| § 1.04 | Allgemeine Sorgfaltspflicht | ||
| § 1.05 | Verhalten unter besonderen Umständen | ||
| § 1.06 | Benutzung der Wasserstraße | ||
| § 1.07 | Anforderungen an die Beladung und Sicht; Höchstzahl der Fahrgäste | ||
| § 1.08 | Bau, Ausrüstung und Besatzung der Fahrzeuge | ||
| § 1.09 | Besetzung des Ruders | ||
| § 1.10 | Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen an Bord | ||
| § 1.10a | Ausnahmen für bestimmte Fahrzeuge in Bezug auf Urkunden und sonstige Unterlagen an Bord | ||
| § 1.11 | Mitführen der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung und des Handbuchs Binnenschifffahrtsfunk an Bord | ||
| § 1.12 | Gefährdung durch Gegenstände an Bord; Verlust von Gegenständen; Schiffahrtshindernisse | ||
| § 1.13 | Schutz der Schiffahrtszeichen | ||
| § 1.14 | Beschädigung von Anlagen | ||
| § 1.15 | Verbot des Einbringens von Gegenständen und Flüssigkeiten in die Wasserstraße | ||
| § 1.16 | Rettung und Hilfeleistung | ||
| § 1.17 | Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge; Anzeige von Unfällen | ||
| § 1.18 | Freimachen des Fahrwassers | ||
| § 1.19 | Besondere Anweisungen | ||
| § 1.20 | Überwachung | ||
| § 1.21 | Sondertransporte; Amphibienfahrzeuge | ||
| § 1.22 | Anordnungen vorübergehender Art der zuständigen Behörde | ||
| § 1.22a | Anordnungen vorübergehender Art der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt | ||
| § 1.23 | Erlaubnis besonderer Veranstaltungen | ||
| § 1.24 | Anwendbarkeit der Verordnung auf Häfen, Lade- und Löschplätze | ||
| § 1.25 | Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen | ||
| § 1.26 | Abweichungen von dieser Verordnung für ein Fahrzeug, bei dem Aufgaben der Besatzung automatisiert wahrgenommen werden, oder für ein ferngesteuertes Fahrzeug | ||
| Kapitel 2 | |||
| Kennzeichnung und Tiefgangsanzeiger der Fahrzeuge; Schiffseichung | |||
| § 2.01 | Kennzeichen der Fahrzeuge, ausgenommen Kleinfahrzeuge und Seeschiffe | ||
| § 2.02 | Kennzeichen der Kleinfahrzeuge | ||
| § 2.03 | Schiffseichung | ||
| § 2.04 | Einsenkungsmarken und Tiefgangsanzeiger | ||
| § 2.05 | Kennzeichen der Anker | ||
| § 2.06 | Kennzeichnung der Fahrzeuge, die Flüssigerdgas (LNG) als Brennstoff nutzen | ||
| Kapitel 3 | |||
| Bezeichnung der Fahrzeuge | |||
| Abschnitt I: Allgemeines | |||
| § 3.01 | Begriffsbestimmungen und Anwendungen | ||
| § 3.02 | Lichter | ||
| § 3.03 | Flaggen, Tafeln und Wimpel | ||
| § 3.04 | Zylinder, Bälle und Kegel | ||
| § 3.05 | Verbotene oder ausnahmsweise zugelassene Lichter und Sichtzeichen | ||
| § 3.06 | (ohne Inhalt) | ||
| § 3.07 | Verbotener Gebrauch von Lichtern, Scheinwerfern, Flaggen, Tafeln und Wimpeln usw. | ||
| Abschnitt II: Nacht- und Tagbezeichnung | |||
| Titel A: Bezeichnung während der Fahrt | |||
| § 3.08 | Bezeichnung einzeln fahrender Fahrzeuge mit Maschinenantrieb | ||
| § 3.09 | Bezeichnung der Schleppverbände in Fahrt | ||
| § 3.10 | Bezeichnung der Schubverbände in Fahrt | ||
| § 3.11 | Bezeichnung gekuppelter Fahrzeuge in Fahrt | ||
| § 3.12 | Bezeichnung der Fahrzeuge unter Segel in Fahrt | ||
| § 3.13 | Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt | ||
| § 3.14 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | ||
| § 3.15 | Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt, die zur Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen sind und deren Schiffskörper eine Höchstlänge von weniger als 20,00 m aufweist | ||
| § 3.16 | Bezeichnung der Fähren in Fahrt | ||
| § 3.17 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt, die einen Vorrang besitzen | ||
| § 3.18 | Zusätzliche Bezeichnung manövrierunfähiger Fahrzeuge in Fahrt | ||
| § 3.19 | Bezeichnung der Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen in Fahrt | ||
| Titel B: Bezeichnung beim Stilliegen | |||
| § 3.20 | Bezeichnung der Fahrzeuge beim Stilliegen | ||
| § 3.21 | Zusätzliche Bezeichnung stilliegender Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | ||
| § 3.22 | Bezeichnung der Fähren, die an ihrer Anlegestelle stilliegen | ||
| § 3.23 | Bezeichnung der Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen beim Stilliegen | ||
| § 3.24 | Bezeichnung bestimmter stilliegender Fischereifahrzeuge und der Netze oder Ausleger | ||
| § 3.25 | Bezeichnung schwimmender Geräte bei der Arbeit sowie festgefahrener oder gesunkener Fahrzeuge | ||
| § 3.26 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen, deren Anker die Schiffahrt gefährden können, und ihrer Anker | ||
| Abschnitt III: Sonstige Bezeichnung | |||
| § 3.27 | Bezeichnung der Fahrzeuge der Überwachungsbehörden | ||
| § 3.28 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt, die Arbeiten im Fahrwasser ausführen | ||
| § 3.29 | Schutz gegen Wellenschlag | ||
| § 3.30 | Notzeichen | ||
| § 3.31 | Hinweis auf das Verbot, das Fahrzeug zu betreten | ||
| § 3.32 | Hinweis auf das Verbot, zu rauchen, ungeschütztes Licht oder Feuer zu verwenden | ||
| § 3.33 | Hinweis auf das Verbot des Stilliegens nebeneinander | ||
| § 3.34 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge beim Einsatz von Tauchern | ||
| Kapitel 4 | |||
| Schallzeichen der Fahrzeuge; Sprechfunk; Informations- und Navigationsgeräte | |||
| Abschnitt I: Schallzeichen | |||
| § 4.01 | Allgemeines | ||
| § 4.02 | Gebrauch der Schallzeichen | ||
| § 4.03 | Verbotene Schallzeichen | ||
| § 4.04 | Notzeichen | ||
| Abschnitt II: Sprechfunk | |||
| § 4.05 | Sprechfunk | ||
| Abschnitt III. Informations- und Navigationsgeräte | |||
| § 4.06 | Radar | ||
| § 4.07 | Inland AIS und Inland ECDIS | ||
| Kapitel 5 | |||
| Schiffahrtszeichen und Bezeichnung der Wasserstraße | |||
| § 5.01 | Schiffahrtszeichen | ||
| § 5.02 | Bezeichnung der Wasserstraße | ||
| Kapitel 6 | |||
| Fahrregeln | |||
| Abschnitt I: Allgemeines | |||
| § 6.01 | Schnelle Schiffe | ||
| § 6.02 | Gegenseitiges Verhalten von Kleinfahrzeugen und anderen Fahrzeugen | ||
| § 6.02a | Besondere Fahrregeln für Kleinfahrzeuge untereinander | ||
| Abschnitt II: Begegnen und Überholen | |||
| § 6.03 | Allgemeine Grundsätze | ||
| § 6.04 | Begegnen: Grundregeln | ||
| § 6.05 | Begegnen: Ausnahmen von den Grundregeln | ||
| § 6.06 | Begegnen von schnellen Schiffen mit anderen Fahrzeugen und untereinander | ||
| § 6.07 | Begegnen im engen Fahrwasser | ||
| § 6.08 | Durch Schiffahrtszeichen verbotenes Begegnen | ||
| § 6.09 | Überholen: Allgemeine Bestimmungen | ||
| § 6.10 | Überholen: Verhalten und Zeichengebung der Fahrzeuge | ||
| § 6.11 | Überholverbot durch Schiffahrtszeichen | ||
| Abschnitt III: Weitere Regeln für die Fahrt | |||
| § 6.12 | Fahrt auf Strecken mit vorgeschriebenem Kurs | ||
| § 6.13 | Wenden | ||
| § 6.14 | Verhalten bei der Abfahrt | ||
| § 6.15 | Verbot des Hineinfahrens in die Abstände zwischen Teilen eines Schleppverbandes | ||
| § 6.16 | Einfahrt in und Ausfahrt aus Häfen und Nebenwasserstraßen | ||
| § 6.17 | Fahrt auf gleicher Höhe; Verbot der Annäherung an Fahrzeuge | ||
| § 6.18 | Verbot des Schleifenlassens von Ankern, Trossen oder Ketten | ||
| § 6.19 | Schiffahrt durch Treibenlassen | ||
| § 6.20 | Vermeidung von Wellenschlag | ||
| § 6.21 | Zusammenstellung der Verbände | ||
| § 6.22 | Sperrung der Schiffahrt und gesperrte Wasserflächen | ||
| § 6.22a | Vorbeifahrt an schwimmenden Geräten bei der Arbeit sowie an festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugen | ||
| Abschnitt IV: Fähren | |||
| § 6.23 | Verhalten der Fähren | ||
| Abschnitt V: Durchfahren von Brücken, Wehren und Schleusen | |||
| § 6.24 | Durchfahren von Brücken und Wehren: Allgemeines | ||
| § 6.25 | Durchfahrt unter festen Brücken | ||
| § 6.26 | Durchfahrt durch Schiffbrücken | ||
| § 6.27 | Durchfahren der Wehre | ||
| § 6.28 | Durchfahren der Schleusen | ||
| § 6.28a | Schleuseneinfahrt und -ausfahrt | ||
| § 6.29 | Vorrecht auf Schleusung | ||
| Abschnitt VI: Unsichtiges Wetter; Benutzung von Radar | |||
| § 6.30 | Alle fahrenden Fahrzeuge bei unsichtigem Wetter | ||
| § 6.31 | Stillliegende Fahrzeuge | ||
| § 6.32 | Mit Radar fahrende Fahrzeuge | ||
| § 6.33 | Nicht mit Radar fahrende Fahrzeuge | ||
| Kapitel 7 | |||
| Regeln für das Stilliegen | |||
| § 7.01 | Allgemeine Grundsätze für das Stilliegen | ||
| § 7.02 | Liegeverbot | ||
| § 7.03 | Ankern und Benutzung von Ankerpfählen | ||
| § 7.04 | Festmachen | ||
| § 7.05 | Liegestellen | ||
| § 7.06 | Besondere Liegestellen | ||
| § 7.07 | Mindestabstände bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter beim Stilliegen | ||
| § 7.08 | Wache und Aufsicht | ||
| Kapitel 8 | |||
| Zusatzbestimmungen | |||
| § 8.01 | Geschleppte und schleppende Schubverbände | ||
| § 8.02 | Schubverbände, die andere Fahrzeuge als Schubleichter mitführen | ||
| § 8.03 | Schubverbände, die Trägerschiffsleichter mitführen | ||
| § 8.04 | Fortbewegung von Schubleichtern außerhalb eines Schubverbandes | ||
| § 8.05 | Kupplungen der Schubverbände | ||
| § 8.06 | Sprechverbindung auf Verbänden | ||
| § 8.07 | Begehbarkeit der Schubverbände | ||
| § 8.08 | Zusammenstellung der Schleppverbände | ||
| § 8.09 | Bleib-weg-Signal | ||
| § 8.10 | Sicherheit an Bord von Fahrzeugen, die für die Beförderung und Übernachtung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen sind | ||
| § 8.11 | Sicherheit an Bord der Fahrzeuge, die Flüssigerdgas (LNG) als Brennstoff nutzen | ||
| Zweiter Teil | |||
| Sonderbestimmungen für einzelne Rheinstrecken | |||
| Kapitel 9 | |||
| Besondere Regeln für die Fahrt und das Stilliegen | |||
| § 9.01 | Beschränkungen der Schiffahrt in Basel | ||
| § 9.02 | Großer Elsässischer Kanal und kanalisierter Rhein | ||
| § 9.03 | Vorbeifahrt an der Fähre Seltz-Plittersdorf | ||
| § 9.04 | Geregelte Begegnung | ||
| § 9.05 | Fahrt von Fahrzeugen und Verbänden auf gleicher Höhe | ||
| § 9.06 | Befahren der Altrheine zwischen Mannheim und Mainz | ||
| § 9.07 | Beschränkungen der Schiffahrt | ||
| § 9.08 | Nachtschifffahrt auf der Strecke Bingen-St. Goar | ||
| § 9.09 | Beschränkung der Schifffahrt zwischen Bad Salzig (km 564,30) und Gorinchem (km 952,50) | ||
| § 9.10 | Bezeichnung und Fahrregeln von Mehrzweckfahrzeugen der Bundeswehr zwischen den Schleusen Iffezheim und der Spyck'schen Fähre | ||
| § 9.11 | Fahrt bei unsichtigem Wetter unterhalb der Spyck'schen Fähre | ||
| Kapitel 10 | |||
| Beschränkung der Schiffahrt bei Hochwasser und bei Niedrigwasser | |||
| § 10.01 | Beschränkung der Schiffahrt bei Hochwasser oberhalb der Spyck'schen Fähre | ||
| § 10.02 | Beschränkung der Schiffahrt bei Niedrigwasser zwischen Bingen und St. Goar | ||
| Kapitel 11 | |||
| Höchstabmessungen der Fahrzeuge, Schubverbände und sonstiger Fahrzeugzusammenstellungen | |||
| § 11.01 | Höchstabmessungen der Fahrzeuge | ||
| § 11.02 | Höchstabmessungen der Schubverbände und der gekuppelten Fahrzeuge | ||
| Kapitel 12 | |||
| Stromstrecken mit Meldepflicht oder mit Wahrschauregelung | |||
| § 12.01 | Meldepflicht | ||
| § 12.02 | Funktion der Lichtwahrschau auf der Strecke Oberwesel – St. Goar | ||
| § 12.03 | Besondere Regeln für die Fahrt in der Wahrschaustrecke | ||
| Kapitel 13 | |||
| Besondere Bestimmungen für den Verkehr der Kanalpenichen auf der Strecke Basel bis Schleusen Iffezheim | |||
| § 13.01 | Anwendungsbereich | ||
| § 13.02 | Kennzeichnung der Fahrzeuge | ||
| § 13.03 | Einsenkungsmarken | ||
| § 13.04 | Tiefgangsanzeiger | ||
| § 13.05 | Unterscheidungszeichen der Anker | ||
| § 13.06 | Zusammenstellung der Verbände | ||
| Kapitel 14 | |||
| Vorschriften für die Reeden auf dem Rhein | |||
| § 14.01 | Allgemeine Bestimmungen | ||
| § 14.02 | Basel | ||
| § 14.03 | Mannheim-Ludwigshafen | ||
| § 14.04 | Mainz | ||
| § 14.05 | Bingen | ||
| § 14.06 | Bad Salzig | ||
| § 14.07 | Koblenz | ||
| § 14.08 | Andernach | ||
| § 14.09 | Wesseling | ||
| § 14.10 | Duisburg-Ruhrort | ||
| § 14.11 | (ohne Inhalt) Übernachtungshäfen Boven-Rijn, Waal und Lek | ||
| § 14.12 | (weggefallen) Schutz- und Sicherheitshafen Emmerich | ||
| § 14.13 | Ijzendoorn und Haaften | ||
| Dritter Teil | |||
| Umweltbestimmungen | |||
| Kapitel 15 | |||
| Gewässerschutz und Abfallbeseitigung auf Fahrzeugen | |||
| § 15.01 | Begriffsbestimmungen | ||
| § 15.02 | Allgemeine Sorgfaltspflicht | ||
| § 15.03 | Verbot der Einbringung und Einleitung | ||
| § 15.04 | Sammlung und Behandlung an Bord | ||
| § 15.05 | Ölkontrollbuch, Abgabe an Annahmestellen | ||
| § 15.06 | Sorgfaltspflicht beim Bunkern | ||
| § 15.07 | Sorgfaltspflicht beim Bunkern von Flüssigerdgas (LNG) | ||
| § 15.08 | Bilgenentölungsboote | ||
| § 15.09 | Anstrich und Außenreinigung der Fahrzeuge | ||
| Anlagen | |||
| Anlage 1: | Unterscheidungsbuchstabe oder -buchstabengruppe des Landes, in welchem der Heimat- oder Registerort der Fahrzeuge liegt | ||
| Anlage 2: | (ohne Inhalt) | ||
| Anlage 3: | Bezeichnung der Fahrzeuge | ||
| Anlage 4: | (ohne Inhalt) | ||
| Anlage 5: | (ohne Inhalt) | ||
| Anlage 6: | Schallzeichen | ||
| Anlage 7: | Schiffahrtszeichen | ||
| Anlage 8: | Bezeichnung der Wasserstraße | ||
| Anlage 9: | Lichtwahrschau Oberwesel – St. Goar Rhein-km 548,50 – 555,43 | ||
| Anlage 10: | Muster für das Ölkontrollbuch | ||
| Anlage 11: | Daten, die in das Inland AIS Gerät einzugeben sind: Erläuterungen „Navigationsstatus“ und des Bezugspunktes der Positionsinformation auf dem Fahrzeug | ||
| Anlage 12: | Verzeichnis der Fahrzeug- und Verbandsarten | ||
| Anlage 13: | Verzeichnis der mitzuführenden Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 RheinSchPV | ||
| Erster Teil | |||
| Auf der gesamten Rheinstrecke anwendbare Bestimmungen | |||
| Kapitel 1 | |||
| Allgemeine Bestimmungen | |||
| § 1.01 | Begriffsbestimmungen | ||
| § 1.02 | Schiffsführer | ||
| § 1.03 | Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord | ||
| § 1.04 | Allgemeine Sorgfaltspflicht | ||
| § 1.05 | Verhalten unter besonderen Umständen | ||
| § 1.06 | Benutzung der Wasserstraße | ||
| § 1.07 | Anforderungen an die Beladung und Sicht; Höchstzahl der Fahrgäste | ||
| § 1.08 | Bau, Ausrüstung und Besatzung der Fahrzeuge | ||
| § 1.09 | Besetzung des Ruders | ||
| § 1.10 | Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen an Bord | ||
| § 1.10a | Ausnahmen für bestimmte Fahrzeuge in Bezug auf Urkunden und sonstige Unterlagen an Bord | ||
| § 1.11 | Mitführen der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung und des Handbuchs Binnenschifffahrtsfunk an Bord | ||
| § 1.12 | Gefährdung durch Gegenstände an Bord; Verlust von Gegenständen; Schiffahrtshindernisse | ||
| § 1.13 | Schutz der Schiffahrtszeichen | ||
| § 1.14 | Beschädigung von Anlagen | ||
| § 1.15 | Verbot des Einbringens von Gegenständen und Flüssigkeiten in die Wasserstraße | ||
| § 1.16 | Rettung und Hilfeleistung | ||
| § 1.17 | Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge; Anzeige von Unfällen | ||
| § 1.18 | Freimachen des Fahrwassers | ||
| § 1.19 | Besondere Anweisungen | ||
| § 1.20 | Überwachung | ||
| § 1.21 | Sondertransporte; Amphibienfahrzeuge | ||
| § 1.22 | Anordnungen vorübergehender Art der zuständigen Behörde | ||
| § 1.22a | Anordnungen vorübergehender Art der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt | ||
| § 1.23 | Erlaubnis besonderer Veranstaltungen | ||
| § 1.24 | Anwendbarkeit der Verordnung auf Häfen, Lade- und Löschplätze | ||
| § 1.25 | Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen | ||
| § 1.26 | Abweichungen von dieser Verordnung für ein Fahrzeug, bei dem Aufgaben der Besatzung automatisiert wahrgenommen werden, oder für ein ferngesteuertes Fahrzeug | ||
| Kapitel 2 | |||
| Kennzeichnung und Tiefgangsanzeiger der Fahrzeuge; Schiffseichung | |||
| § 2.01 | Kennzeichen der Fahrzeuge, ausgenommen Kleinfahrzeuge und Seeschiffe | ||
| § 2.02 | Kennzeichen der Kleinfahrzeuge | ||
| § 2.03 | Schiffseichung | ||
| § 2.04 | Einsenkungsmarken und Tiefgangsanzeiger | ||
| § 2.05 | Kennzeichen der Anker | ||
| § 2.06 | Kennzeichnung der Fahrzeuge, die Flüssigerdgas (LNG) als Brennstoff nutzen | ||
| Kapitel 3 | |||
| Bezeichnung der Fahrzeuge | |||
| Abschnitt I: Allgemeines | |||
| § 3.01 | Begriffsbestimmungen und Anwendungen | ||
| § 3.02 | Lichter | ||
| § 3.03 | Flaggen, Tafeln und Wimpel | ||
| § 3.04 | Zylinder, Bälle und Kegel | ||
| § 3.05 | Verbotene oder ausnahmsweise zugelassene Lichter und Sichtzeichen | ||
| § 3.06 | (ohne Inhalt) | ||
| § 3.07 | Verbotener Gebrauch von Lichtern, Scheinwerfern, Flaggen, Tafeln und Wimpeln usw. | ||
| Abschnitt II: Nacht- und Tagbezeichnung | |||
| Titel A: Bezeichnung während der Fahrt | |||
| § 3.08 | Bezeichnung einzeln fahrender Fahrzeuge mit Maschinenantrieb | ||
| § 3.09 | Bezeichnung der Schleppverbände in Fahrt | ||
| § 3.10 | Bezeichnung der Schubverbände in Fahrt | ||
| § 3.11 | Bezeichnung gekuppelter Fahrzeuge in Fahrt | ||
| § 3.12 | Bezeichnung der Fahrzeuge unter Segel in Fahrt | ||
| § 3.13 | Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt | ||
| § 3.14 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | ||
| § 3.15 | Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt, die zur Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen sind und deren Schiffskörper eine Höchstlänge von weniger als 20,00 m aufweist | ||
| § 3.16 | Bezeichnung der Fähren in Fahrt | ||
| § 3.17 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt, die einen Vorrang besitzen | ||
| § 3.18 | Zusätzliche Bezeichnung manövrierunfähiger Fahrzeuge in Fahrt | ||
| § 3.19 | Bezeichnung der Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen in Fahrt | ||
| Titel B: Bezeichnung beim Stilliegen | |||
| § 3.20 | Bezeichnung der Fahrzeuge beim Stilliegen | ||
| § 3.21 | Zusätzliche Bezeichnung stilliegender Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | ||
| § 3.22 | Bezeichnung der Fähren, die an ihrer Anlegestelle stilliegen | ||
| § 3.23 | Bezeichnung der Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen beim Stilliegen | ||
| § 3.24 | Bezeichnung bestimmter stilliegender Fischereifahrzeuge und der Netze oder Ausleger | ||
| § 3.25 | Bezeichnung schwimmender Geräte bei der Arbeit sowie festgefahrener oder gesunkener Fahrzeuge | ||
| § 3.26 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen, deren Anker die Schiffahrt gefährden können, und ihrer Anker | ||
| Abschnitt III: Sonstige Bezeichnung | |||
| § 3.27 | Bezeichnung der Fahrzeuge der Überwachungsbehörden | ||
| § 3.28 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt, die Arbeiten im Fahrwasser ausführen | ||
| § 3.29 | Schutz gegen Wellenschlag | ||
| § 3.30 | Notzeichen | ||
| § 3.31 | Hinweis auf das Verbot, das Fahrzeug zu betreten | ||
| § 3.32 | Hinweis auf das Verbot, zu rauchen, ungeschütztes Licht oder Feuer zu verwenden | ||
| § 3.33 | Hinweis auf das Verbot des Stilliegens nebeneinander | ||
| § 3.34 | Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge beim Einsatz von Tauchern | ||
| Kapitel 4 | |||
| Schallzeichen der Fahrzeuge; Sprechfunk; Informations- und Navigationsgeräte | |||
| Abschnitt I: Schallzeichen | |||
| § 4.01 | Allgemeines | ||
| § 4.02 | Gebrauch der Schallzeichen | ||
| § 4.03 | Verbotene Schallzeichen | ||
| § 4.04 | Notzeichen | ||
| Abschnitt II: Sprechfunk | |||
| § 4.05 | Sprechfunk | ||
| Abschnitt III. Informations- und Navigationsgeräte | |||
| § 4.06 | Radar | ||
| § 4.07 | Inland AIS und Inland ECDIS | ||
| Kapitel 5 | |||
| Schiffahrtszeichen und Bezeichnung der Wasserstraße | |||
| § 5.01 | Schiffahrtszeichen | ||
| § 5.02 | Bezeichnung der Wasserstraße | ||
| Kapitel 6 | |||
| Fahrregeln | |||
| Abschnitt I: Allgemeines | |||
| § 6.01 | Schnelle Schiffe | ||
| § 6.02 | Gegenseitiges Verhalten von Kleinfahrzeugen und anderen Fahrzeugen | ||
| § 6.02a | Besondere Fahrregeln für Kleinfahrzeuge untereinander | ||
| Abschnitt II: Begegnen und Überholen | |||
| § 6.03 | Allgemeine Grundsätze | ||
| § 6.04 | Begegnen: Grundregeln | ||
| § 6.05 | Begegnen: Ausnahmen von den Grundregeln | ||
| § 6.06 | Begegnen von schnellen Schiffen mit anderen Fahrzeugen und untereinander | ||
| § 6.07 | Begegnen im engen Fahrwasser | ||
| § 6.08 | Durch Schiffahrtszeichen verbotenes Begegnen | ||
| § 6.09 | Überholen: Allgemeine Bestimmungen | ||
| § 6.10 | Überholen: Verhalten und Zeichengebung der Fahrzeuge | ||
| § 6.11 | Überholverbot durch Schiffahrtszeichen | ||
| Abschnitt III: Weitere Regeln für die Fahrt | |||
| § 6.12 | Fahrt auf Strecken mit vorgeschriebenem Kurs | ||
| § 6.13 | Wenden | ||
| § 6.14 | Verhalten bei der Abfahrt | ||
| § 6.15 | Verbot des Hineinfahrens in die Abstände zwischen Teilen eines Schleppverbandes | ||
| § 6.16 | Einfahrt in und Ausfahrt aus Häfen und Nebenwasserstraßen | ||
| § 6.17 | Fahrt auf gleicher Höhe; Verbot der Annäherung an Fahrzeuge | ||
| § 6.18 | Verbot des Schleifenlassens von Ankern, Trossen oder Ketten | ||
| § 6.19 | Schiffahrt durch Treibenlassen | ||
| § 6.20 | Vermeidung von Wellenschlag | ||
| § 6.21 | Zusammenstellung der Verbände | ||
| § 6.22 | Sperrung der Schiffahrt und gesperrte Wasserflächen | ||
| § 6.22a | Vorbeifahrt an schwimmenden Geräten bei der Arbeit sowie an festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugen | ||
| Abschnitt IV: Fähren | |||
| § 6.23 | Verhalten der Fähren | ||
| Abschnitt V: Durchfahren von Brücken, Wehren und Schleusen | |||
| § 6.24 | Durchfahren von Brücken und Wehren: Allgemeines | ||
| § 6.25 | Durchfahrt unter festen Brücken | ||
| § 6.26 | Durchfahrt durch Schiffbrücken | ||
| § 6.27 | Durchfahren der Wehre | ||
| § 6.28 | Durchfahren der Schleusen | ||
| § 6.28a | Schleuseneinfahrt und -ausfahrt | ||
| § 6.29 | Vorrecht auf Schleusung | ||
| Abschnitt VI: Unsichtiges Wetter; Benutzung von Radar | |||
| § 6.30 | Alle fahrenden Fahrzeuge bei unsichtigem Wetter | ||
| § 6.31 | Stillliegende Fahrzeuge | ||
| § 6.32 | Mit Radar fahrende Fahrzeuge | ||
| § 6.33 | Nicht mit Radar fahrende Fahrzeuge | ||
| Kapitel 7 | |||
| Regeln für das Stilliegen | |||
| § 7.01 | Allgemeine Grundsätze für das Stilliegen | ||
| § 7.02 | Liegeverbot | ||
| § 7.03 | Ankern und Benutzung von Ankerpfählen | ||
| § 7.04 | Festmachen | ||
| § 7.05 | Liegestellen | ||
| § 7.06 | Besondere Liegestellen | ||
| § 7.07 | Mindestabstände bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter beim Stilliegen | ||
| § 7.08 | Wache und Aufsicht | ||
| Kapitel 8 | |||
| Zusatzbestimmungen | |||
| § 8.01 | Geschleppte und schleppende Schubverbände | ||
| § 8.02 | Schubverbände, die andere Fahrzeuge als Schubleichter mitführen | ||
| § 8.03 | Schubverbände, die Trägerschiffsleichter mitführen | ||
| § 8.04 | Fortbewegung von Schubleichtern außerhalb eines Schubverbandes | ||
| § 8.05 | Kupplungen der Schubverbände | ||
| § 8.06 | Sprechverbindung auf Verbänden | ||
| § 8.07 | Begehbarkeit der Schubverbände | ||
| § 8.08 | Zusammenstellung der Schleppverbände | ||
| § 8.09 | Bleib-weg-Signal | ||
| § 8.10 | Sicherheit an Bord von Fahrzeugen, die für die Beförderung und Übernachtung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen sind | ||
| § 8.11 | Sicherheit an Bord der Fahrzeuge, die Flüssigerdgas (LNG) als Brennstoff nutzen | ||
| Zweiter Teil | |||
| Sonderbestimmungen für einzelne Rheinstrecken | |||
| Kapitel 9 | |||
| Besondere Regeln für die Fahrt und das Stilliegen | |||
| § 9.01 | Beschränkungen der Schiffahrt in Basel | ||
| § 9.02 | Großer Elsässischer Kanal und kanalisierter Rhein | ||
| § 9.03 | Vorbeifahrt an der Fähre Seltz-Plittersdorf | ||
| § 9.04 | Geregelte Begegnung | ||
| § 9.05 | Fahrt von Fahrzeugen und Verbänden auf gleicher Höhe | ||
| § 9.06 | Befahren der Altrheine zwischen Mannheim und Mainz | ||
| § 9.07 | Beschränkungen der Schiffahrt | ||
| § 9.08 | Nachtschifffahrt auf der Strecke Bingen-St. Goar | ||
| § 9.09 | Beschränkung der Schifffahrt zwischen Bad Salzig (km 564,30) und Gorinchem (km 952,50) | ||
| § 9.10 | Bezeichnung und Fahrregeln von Mehrzweckfahrzeugen der Bundeswehr zwischen den Schleusen Iffezheim und der Spyck'schen Fähre | ||
| § 9.11 | Fahrt bei unsichtigem Wetter unterhalb der Spyck'schen Fähre | ||
| Kapitel 10 | |||
| Beschränkung der Schiffahrt bei Hochwasser und bei Niedrigwasser | |||
| § 10.01 | Beschränkung der Schiffahrt bei Hochwasser oberhalb der Spyck'schen Fähre | ||
| § 10.02 | Beschränkung der Schiffahrt bei Niedrigwasser zwischen Bingen und St. Goar | ||
| Kapitel 11 | |||
| Höchstabmessungen der Fahrzeuge, Schubverbände und sonstiger Fahrzeugzusammenstellungen | |||
| § 11.01 | Höchstabmessungen der Fahrzeuge | ||
| § 11.02 | Höchstabmessungen der Schubverbände und der gekuppelten Fahrzeuge | ||
| Kapitel 12 | |||
| Stromstrecken mit Meldepflicht oder mit Wahrschauregelung | |||
| § 12.01 | Meldepflicht | ||
| § 12.02 | Funktion der Lichtwahrschau auf der Strecke Oberwesel – St. Goar | ||
| § 12.03 | Besondere Regeln für die Fahrt in der Wahrschaustrecke | ||
| Kapitel 13 | |||
| Besondere Bestimmungen für den Verkehr der Kanalpenichen auf der Strecke Basel bis Schleusen Iffezheim | |||
| § 13.01 | Anwendungsbereich | ||
| § 13.02 | Kennzeichnung der Fahrzeuge | ||
| § 13.03 | Einsenkungsmarken | ||
| § 13.04 | Tiefgangsanzeiger | ||
| § 13.05 | Unterscheidungszeichen der Anker | ||
| § 13.06 | Zusammenstellung der Verbände | ||
| Kapitel 14 | |||
| Vorschriften für die Reeden auf dem Rhein | |||
| § 14.01 | Allgemeine Bestimmungen | ||
| § 14.02 | Basel | ||
| § 14.03 | Mannheim-Ludwigshafen | ||
| § 14.04 | Mainz | ||
| § 14.05 | Bingen | ||
| § 14.06 | Bad Salzig | ||
| § 14.07 | Koblenz | ||
| § 14.08 | Andernach | ||
| § 14.09 | Wesseling | ||
| § 14.10 | Duisburg-Ruhrort | ||
| § 14.11 | (ohne Inhalt) Übernachtungshäfen Boven-Rijn, Waal und Lek | ||
| § 14.12 | (weggefallen) Schutz- und Sicherheitshafen Emmerich | ||
| § 14.13 | Ijzendoorn und Haaften | ||
| Dritter Teil | |||
| Umweltbestimmungen | |||
| Kapitel 15 | |||
| Gewässerschutz und Abfallbeseitigung auf Fahrzeugen | |||
| § 15.01 | Begriffsbestimmungen | ||
| § 15.02 | Allgemeine Sorgfaltspflicht | ||
| § 15.03 | Verbot der Einbringung und Einleitung | ||
| § 15.04 | Sammlung und Behandlung an Bord | ||
| § 15.05 | Ölkontrollbuch, Abgabe an Annahmestellen | ||
| § 15.06 | Sorgfaltspflicht beim Bunkern | ||
| § 15.07 | Sorgfaltspflicht beim Bunkern von Flüssigerdgas (LNG) | ||
| § 15.08 | Bilgenentölungsboote | ||
| § 15.09 | Anstrich und Außenreinigung der Fahrzeuge | ||
| Anlagen | |||
| Anlage 1: | Unterscheidungsbuchstabe oder -buchstabengruppe des Landes, in welchem der Heimat- oder Registerort der Fahrzeuge liegt | ||
| Anlage 2: | (ohne Inhalt) | ||
| Anlage 3: | Bezeichnung der Fahrzeuge | ||
| Anlage 4: | (ohne Inhalt) | ||
| Anlage 5: | (ohne Inhalt) | ||
| Anlage 6: | Schallzeichen | ||
| Anlage 7: | Schiffahrtszeichen | ||
| Anlage 8: | Bezeichnung der Wasserstraße | ||
| Anlage 9: | Lichtwahrschau Oberwesel – St. Goar Rhein-km 548,50 – 555,43 | ||
| Anlage 10: | Muster für das Ölkontrollbuch | ||
| Anlage 11: | Daten, die in das Inland AIS Gerät einzugeben sind: Erläuterungen „Navigationsstatus“ und des Bezugspunktes der Positionsinformation auf dem Fahrzeug | ||
| Anlage 12: | Verzeichnis der Fahrzeug- und Verbandsarten | ||
| Anlage 13: | Verzeichnis der mitzuführenden Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 RheinSchPV | ||